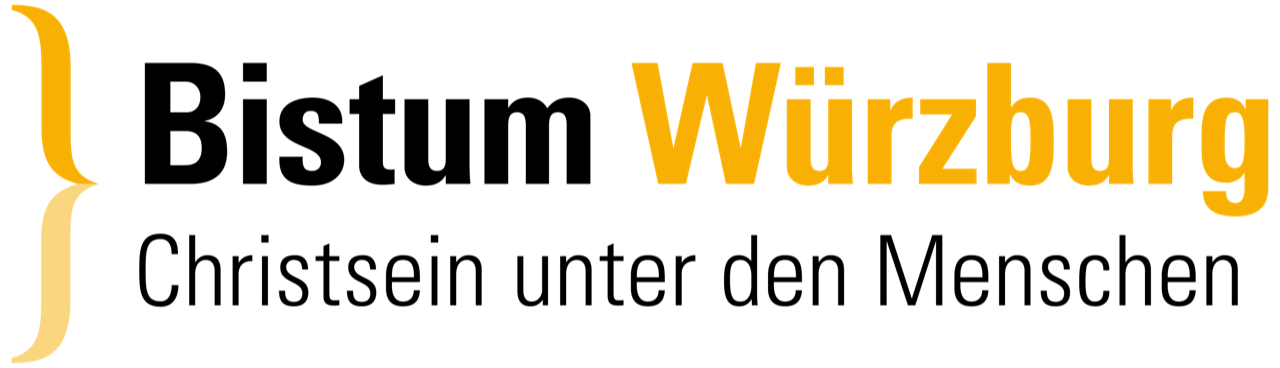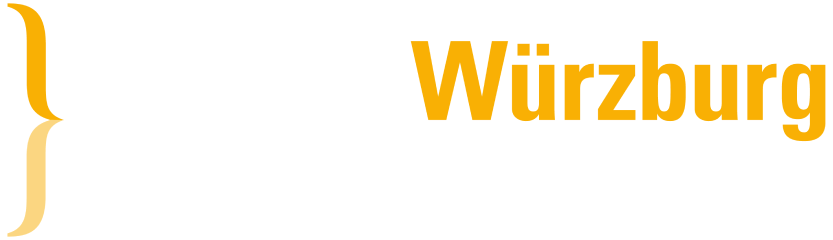Liebe Schwestern und Brüder,
„Um es klar zu sagen: Der Heilige Geist ist für uns eine Belästigung. Er bewegt uns, er lässt uns unterwegs sein, er drängt die Kirche, weiter zu gehen. Aber wir sind wie Petrus bei der Verklärung: ‚Ah, wie schön ist es doch, gemeinsam hier zu sein.’ Das fordert uns aber nicht heraus. Wir wollen, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen ihn zähmen. Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie der Wind, der weht, wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. Es ist dieses ‚vorwärts gehen’, das für uns so anstrengend ist. Die Bequemlichkeit gefällt uns viel besser.“
So hat Papst Franziskus am 16. April 2013 gesagt, wenige Wochen nach seiner Wahl. Das Zitat über den Heiligen Geist liest sich wie ein Spiegel seiner eigenen Amtszeit. Denn dieser Papst setzte ganz andere Akzente als seine beiden direkten Vorgänger im Amt. Die Beunruhigung, die er dem Heiligen Geist attestierte, war auch in jeder seiner Ansprachen und in seinen öffentlichen Auftritten zu spüren. Anstatt auf ungebrochene Kontinuität zu setzen und die Institution Kirche zu stabilisieren, setzte er auf Unterbrechung und Störung eines Kirchenbetriebs, dessen Selbstbezüglichkeit ihm ein Dorn im Auge zu sein schien.
Das begann schon mit der Wahl seines Namens. Der heilige Franziskus war für den mächtigsten Papst des Mittelalters, Innozenz III., eine Provokation. Statt auf Macht setzte der heilige Franziskus konsequent auf Armut. Die Institutionenkritik des Poverello lebte in Papst Franziskus fort.
Geharnischte Worte, wie überhaupt eine sehr bildreiche, kraftvolle Sprache, wurden zu seinem Markenzeichen. Er verstand sich nicht als theologischer Lehrer, sondern wollte als erster Seelsorger seiner Kirche die Gläubigen weltweit aufrütteln. Das hat er in der Tat oft getan, inspiriert vom Geist, der belästigen will und nicht einschläfern möchte. Zu dieser aufrüttelnden Rhetorik zählte seine Dauerkritik am „Klerikalismus“ als der schier unausrottbaren Geisel der Kirche. Unvergessen ist ebenso der oft zitierte Satz: „Diese Wirtschaft tötet.“
Damit die Theologie nicht in Weltfremdheit abgleitet, setzte er provokante Zeichen, den Zeichenhandlungen der alten Propheten nicht unähnlich.
So war es der Papst, der als erster nach Lampedusa flog, um bei den Geflüchteten zu sein und auf ihr Elend aufmerksam zu machen. Das Abendmahlsamt am Gründonnerstag feierte er im Gefängnis, um allen die Füße zu waschen, unabhängig von religiöser Überzeugung, Geschlecht und Herkunft. In Zeiten von Corona waren es die Bilder vom einsamen Papst auf dem Petersplatz, der mit der Ikone der „Salus Populi Romani“ weltweit Fürbitte hielt für eine Menschheit, die grausam aus der Illusion erwacht war, man könne „in einer kranken Welt gesund leben“, wie er eindringlich mahnte.
Seine Botschaft war dabei immer dieselbe: Kirche muss „an die Ränder gehen“ und bei den leidenden Gliedern des Leibes Christi präsent sein. Und Kirche ist für alle da, weil in Christus alle Schwestern und Brüder sind, eben „Fratelli Tutti“. Alle tragen gemeinsam Verantwortung für das Eine Haus unserer Erde inmitten der bedrohten Schöpfung Gottes. Aufgabe der Kirche ist es daher, Motor weltweiter Solidarität zu sein. Kirche versteht sich als universales Sakrament des Heils. Wo sie das nicht oder nicht mehr ist, verrät sie ihre eigene Sendung. Deshalb auch war ihm eine „verbeulte Kirche“, die in ihrer Mission ordentlich gebeutelt und durchgeschüttelt wurde, lieber als eine weltfremde Kirche, die nur um ihre eigene Sicherheit besorgt ist.
Für sein Bild von Kirche diente ihm das Gleichnis vom barmherzigen Samariter als wichtigster Referenztext. Aus ihm leitete er die Bedeutung der Barmherzigkeit Gottes ab, die er wie kein anderer Papst vor ihm stark machte. Barmherzigkeit und Zärtlichkeit, das waren die Kategorien, die er in den theologischen Diskurs neu einführte und die – das war ihm immer besonders wichtig – unmittelbar praktische Konsequenzen nach sich zogen. Denn diese Barmherzigkeit musste erfahrbar sein bei allen, die im Dienst der Kirche stehen. Das galt vor allem für den barmherzigen und zärtlichen Umgang mit den Armen und Schwachen. Männer und Frauen der Kirche sollten anderen zu geistlichen Vätern und Müttern werden. Sie sollten nicht in eine sterile „alte Junggesellen“- oder „alte Jungfern“-Mentalität verfallen, wie er wiederholt warnte.
Seine Kirche deutete der Papst zuerst als „Feldlazarett“ inmitten einer zutiefst verwundeten Menschheit. Anstatt zu verurteilen, sollte die Kirche heilen. Die Duschen auf dem Petersplatz für Obdachlose und das Denkmal für die Geflüchteten verliehen all dem sichtbaren Ausdruck. Anstatt zu belehren, sollte die Kirche Menschen auf ihrem Weg zu Christus begleiten. Das zeigte sich besonders deutlich in der Kurienreform.
Hier verdrängte das neu gebildete „Dikasterium für die Evangelisierung“ das altehrwürdige „Dikasterium für die Glaubenslehre“ vom ersten Platz unter den Dikasterien. Dass Mission Chefsache ist und nicht delegiert werden kann, unterstrich er dadurch, dass er sich den Vorsitz im „Dikasterium für die Evangelisierung“ selbst vorbehielt. „Kirche hat nicht nur eine Mission, sondern sie ist ihrem Wesen nach Mission!“, das war die Botschaft, die er durch diese Neuordnung der Kurie senden wollte.
Feldlazarett kann man allerdings nur sein, wenn man sich den leidenden Menschen aussetzt. Deshalb betonte der Papst immer wieder die Bedeutung des direkten Kontaktes. Einander in die Augen sehen und einander zuhören waren seiner Auffassung nach die wichtigsten pastoralen Fähigkeiten. Der Hirte selbst musste „den Geruch der Schafe“ kennen, bevor er den Anspruch erhob, sie leiten zu können, wollte er den Kontakt zu seiner Herde nicht verlieren.
Dieses einander in die Augen sehen und einander zuhören machte er auch stark für die innerkirchlichen Beratungsprozesse. In Sachen „Synodalität“ sah er großen Nachholbedarf. Gemäß seinem Prinzip „Die Wirklichkeit ist wichtiger als die Idee“ wollte er im direkten Zuhören erfahren, was die aktuellen Probleme der Menschen, der Jugendlichen, der Familien, der Ortskirchen weltweit sind. Mit seiner Neuinterpretation kirchlicher Beratungsformate setzte er wesentliche Akzente. Dabei ließ der Papst die Weltkirche teilhaben an seinem Suchprozess nach dem, was „Synodalität“ heißen und wie man sie erfolgversprechend praktizieren könnte.
Gemäß dem jesuitischen Grundsatz des „Experiments“, Neues einfach einmal auszuprobieren, auch wenn man noch nicht absehen kann, was genau dabei herauskommen wird, ging er beherzt ungewohnte Schritte. Zu diesen zählt sicher auch die überraschende Ernennung der Ordensfrau Raffaela Petrini zur ersten Regierungschefin des Vatikanstaats in der Kirchengeschichte. Prozesse in Gang zu setzen, die auf lange Frist Früchte tragen, war ihm wichtiger, als Positionen zu behaupten. Dies korrespondiert mit einem anderen seiner Prinzipien, das da lautete: „Die Zeit ist mehr wert als der Raum.“ Denn Veränderung braucht einen langen Atem. So schlug Franziskus auch Schneisen, durch die erst ein Nachfolger wird weitergehen können.
Seine Aufmerksamkeit für die Menschen am Rand wirkte sich auch innerkirchlich aus im Blick auf überraschende Kardinalserhebungen.
Während die alten, stolzen Bischofssitze vor allem in Europa leer ausgingen, wurden plötzlich Bischöfe buchstäblich von den Rändern der Weltkirche in den Kardinalsstand erhoben. Kriterium für die Auswahl der Purpurträger war ihr Einsatz wiederum für die Menschen am Rande der Gesellschaft. Papst Franziskus wollte keine Kirchenfunktionäre, sondern Seelsorger, die sich wie er den Menschen mit Leib und Seele verbunden wussten und bereit waren, für ihre Herde einiges zu riskieren.
Auch wenn in den vergangenen Jahren die Unterbrechungen zunahmen, die durch altersbedingte Krankheitspausen erzwungen wurden, so tat das seiner Vitalität und Lebensfreude doch selten Abbruch. Seiner tiefempfundenen Begeisterung am Glauben verlieh er beredten Ausdruck in den Titeln seiner Enzykliken und Apostolischen Schreiben, in denen das Motiv der Freude immer neu anklang: „Evangelii Gaudium“, „Amoris Laetitia“, „Gaudete et Exsultate“, „Laudate Deum“ und „Laudato Si“, um nur die wichtigsten zu nennen. Die Freude war seiner Überzeugung nach die missionarische Triebkraft einer Kirche, deren Bedienstete nicht mit einer Trauermiene umherlaufen sollten, die auf alle anderen abschreckend wirkt. Seine chronisch gute Laune rührte sicher auch daher, dass er immer neu den unmittelbaren Kontakt zu seinen Mitmenschen in überraschenden Begegnungen, Briefen und Telefonaten suchte, die ihm selbst Lebenselixier waren, wie es schien.
„Wir wollen, dass der Heilige Geist sich beruhigt, wir wollen ihn zähmen. Aber das geht nicht. Denn er ist Gott und ist wie der Wind, der weht, wo er will. Er ist die Kraft Gottes, der uns Trost gibt und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. Es ist dieses ‚vorwärts gehen’, das für uns so anstrengend ist.“
In der Tat, der Pontifikat von Papst Franziskus war oftmals herausfordernd. Viele mussten sich anstrengen, mit der Unbekümmertheit des Papstes Schritt zu halten. Für den Kurs der katholischen Kirche zeichnete Franziskus dabei keine eindeutige Route vor. Wahrscheinlich betrachtete er seinen eigenen Pontifikat bewusst als eine Zeit der Suche und des Übergangs. Zum ersten Mal durften bisher für unumstößlich gehaltene Wahrheiten hinterfragt werden, zumindest konnte man einmal offen über bestimmte Probleme reden, ohne gleich abgemahnt zu werden. Er hatte jedenfalls einen wachen Sensus dafür, dass seine Kirche an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter stand. „Wir erleben nicht eine Epoche des Wandelns, sondern einen Wandel der Epoche“, sagte er eindringlich. Wer wollte ihm da widersprechen?
Angesichts großer Verunsicherung über die Zukunft des Planeten wie der politischen Verhältnisse weltweit sollte das Heilige Jahr 2025 unter dem Leitwort „Pilger der Hoffnung“ Ermutigung sein, um voll Glaubenszuversicht auf dem Weg der Christusnachfolge auszuschreiten. Seine Autobiographie, die rechtzeitig zu Beginn des Heiligen Jahres erschien, trug nicht zufällig den Titel „Hoffe“. In ihr legte er Zeugnis ab von der Kraft gläubiger Hoffnung, die auch ihn durch alle Höhen und Tiefen getragen hatte. Trotz großer Unsicherheiten war ihm immer wichtig gewesen, weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben. Denn er wusste, dass Stillstand in Wahrheit Rückschritt heißt. Der Geist drängt zum Vorwärtsgehen. In diesem Geist hat er nun die letzte Hürde genommen und ist selbst als Pilger der Hoffnung eingegangen in die Freude seines Herrn. Gestärkt haben ihn auf diesem letzten Weg wohl auch die Worte seiner letzten Enzyklika „Dilexit nos“, die wie ein Vermächtnis klangen. In ihr empfahl er die Verehrung des Heiligsten Herzens Jesu allen Gläubigen, eine Frömmigkeit, die ihm entsprechend der ignatianischen Tradition offenbar selbst kostbar geworden war und die ihn trug in Zeiten großer Schwachheit.
Möge der Herr nun dem Apostel der göttlichen Barmherzigkeit selbst barmherzig sein und das gute Werk vollenden, das er in seinem Knecht Franziskus begonnen hat. Er ruhe aus von all seinen Mühen. Danke, Papst Franziskus.