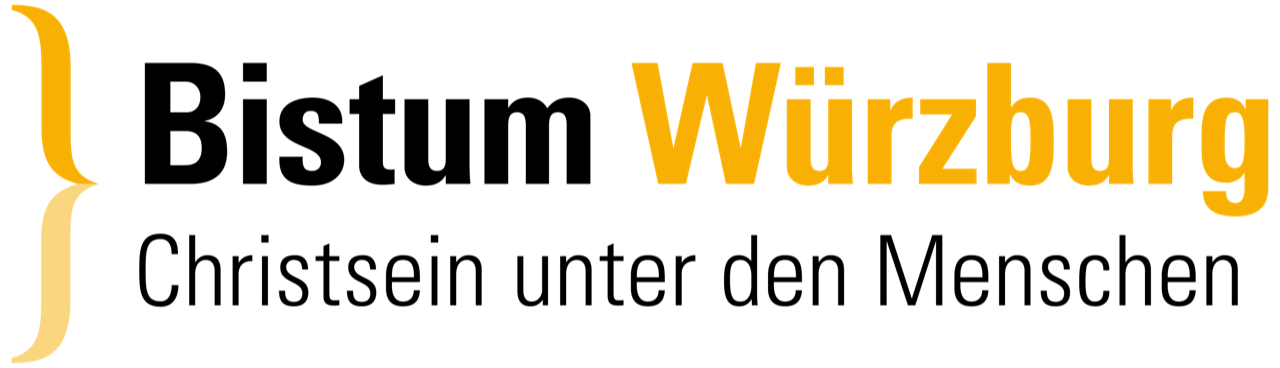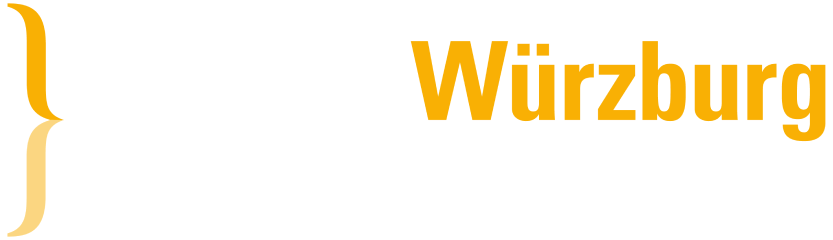Lieber Domkapitular Gabel,
liebe Schwestern und Brüder im Herrn!
Die Beweinung Christi als persönliche Erinnerung Riemenschneiders
Das letzte bekannte Steinbildwerk Tilman Riemenschneiders hat die Kreuzabnahme und die Beweinung Christi zum Thema. Zwischen 1523 und 1526 habe „Meyster Dyln“, wie Riemenschneider seinerzeit genannt wurde, dieses Werk geschaffen – so vermuten zumindest die Fachleute. Somit fällt die Fertigstellung des Altares in eine Zeit, die biographisch für Riemenschneider äußerst einschneidend war, die Zeit des Bauernkriegs nämlich, auf dessen 500. Wiederkehr wir in diesem Festjahr auch noch zurückschauen.
Denn Riemenschneider war nicht nur ein hochangesehener Bildhauer, sondern auch ein gut beleumdeter Ratsherr in Würzburg. Sein Lebensabend ist auf tragische Weise mit den Ereignissen des Bauernkriegs in Würzburg verknüpft. Darf man vermuten, der Meister habe seine Erfahrungen im Bauernkrieg in diesem seinem letzten steinernen Bildwerk reflektiert? Der Zeitansatz zwischen 1523 und 1526 lässt dies zumindest denkbar erscheinen.
Der Gedenktag „Mariä Schmerzen“ als „Schmerzgedächtnis der Kirche“
Diesem Gedanken, der mich persönlich fasziniert, möchte ich in meinen heutigen Ausführungen nachgehen. Ich tue das unter Bezugnahme auf den Gedenktag der Schmerzen Mariens, den wir heute liturgisch feiern. Dieser Gedenktag ist für mich so etwas wie das „Schmerzgedächtnis der Kirche“.
Der Begriff des „Schmerzgedächtnisses“ ist angelehnt an die medizinische Beobachtung, dass menschliche Schmerzrezeptoren sehr schnell lernen. Hält ein akuter Schmerz über längere Zeit an, brennt sich der Schmerz gewissermaßen in das Gedächtnis der Nervenzellen ein. Aus dem akuten Schmerz entwickelt sich ein langanhaltender, chronischer Schmerz.
Das Bild der schmerzensreichen Mutter von Maidbronn zeigt uns den menschlichen Schmerz, der sich seit der Passion Jesu und dem Leid seiner Mutter unvergesslich – gewissermaßen chronisch – in die Heilsgeschichte und die Geschichte der Kirche eingeschrieben hat. Von daher scheint es mir nicht abwegig zu sein, anzunehmen, Tilman Riemenschneider habe auch sich selbst mit seinen eigenen schmerzlichen Erinnerungen in diesem Bild wiedergefunden.
Um welche Schmerzen es sich dabei gehandelt hat, erfahren wir von seinem Kollegen im Stadtrat, dem damaligen Stadtschreiber Martin Cronthal, der uns eine detailreiche und beklemmende Darstellung der Bauernkriegsereignisse hinterlassen hat. Man liest sie bis zum heutigen Tag atemlos wie einen Krimi, weil er höchst anschaulich schildert, was die Menschen, die Verantwortungsträger im Stadtrat zumal, in den Wirren ihrer Zeit durchzustehen hatten. Drei dieser schmerzlichen Erinnerungen möchte ich heute benennen.
Die Ohnmacht angesichts sich überstürzender Ereignisse
Eine erste schmerzliche Erinnerung bezieht sich auf die Ohnmacht des Stadtrats angesichts der Bedrohung Würzburgs durch die Bauern. Cronthal erzählt, wie der Stadtrat anfänglich meinte, die Geschicke der Stadt in den Händen zu haben und die brenzlige Situation meistern zu können. Doch die Ratsmitglieder mussten schnell lernen, dass sich die Ereignisse überschlugen und ihnen die Zügel zusehends entglitten. Gerüchte über die Kriegsvorbereitungen des Fürstbischofs machten die Runde. Hans Bermeter aus dem Hauger Viertel wiegelte systematisch die ärmere Stadtbevölkerung gegen den Rat auf. Berichte über die militärischen Erfolge der Bauern im Odenwald weckten Hoffnungen auf einen baldigen Umsturz. Resigniert notiert der Stadtschreiber: „Nun das Rad gieng und lief alleweil und kunntens nit halten“ (Cronthal S. 46).
„Und kunntens nit halten“ – es gab kein Halten mehr. Die Eskalation der Gewalt nahm ihren Lauf und war nicht mehr zu bremsen. Das Rad lief nicht nur, sondern am Ende kamen alle unter die Räder, die durch anhaltende Agitation gemeint hatten, eine gewaltsame Veränderung der Verhältnisse herbeiführen zu können. Für vernünftige Überlegungen war kein Raum mehr.
Wahrscheinlich sind uns solche Erfahrungen nicht unbekannt. Noch meinen wir, wir könnten die Dinge lenken und hätten das Steuer in der Hand. Doch bald müssen wir einsehen, nicht mehr Herr der Lage zu sein, sondern nur noch Getriebene, die ahnen, dass es kein gutes Ende nehmen wird. Die Ohnmacht, sehenden Auges ins Unglück zu rennen, sind unerträglich. Wie in der Passion Christi übernimmt das Böse das Ruder und führt ins Verderben.
Das Schmerzgedächtnis und die Erfahrung erlittener Ohnmacht im Leben, sie werden im Maidbronner Altar eindrücklich dargestellt im leeren Blick des Jüngers Johannes, der in die Ferne schaut und zugleich seine Hand behutsam, ja gedankenverloren, auf den Arm Mariens legt. Auch die beiden Frauenfiguren am Bildrand – rechts wohl Maria von Magdala – wenden sich von der Bildmitte ab, um sich den Anblick des Leichnams des Herrn und seiner trauernden Mutter zu ersparen. Es gehört zu den Schmerzen Mariens und den Schmerzen der Kirche, Zeugen schlimmer Entwicklungen zu sein, ohne diese aufhalten zu können. Im Los der Gottesmutter hat sich wohl auch Meister Tilman gut wiederfinden können.
Die Qualen ungerechter Folter
Eine zweite schmerzliche Erinnerung bezieht sich auf das Strafgericht, das nach der Niederschlagung des Bauernaufstands über Würzburg hereinbrach. Die Stadt hatte sich auf „Gnad und Ungnad“ dem Fürstbischof zu ergeben (Fries I S. 332). Martin Cronthal berichtet, wie man ihn zusammen mit Riemenschneider und 40 anderen Gefangenen in ein Turmverließ auf der Festung Marienberg sperrte. Mit zwei anderen Gefangenen sei Riemenschneider dann vom Henker „hart gewogen und gemartert worden“ (Cronthal S. 91). Das heißt, man hat ihnen die Arme auf dem Rücken zusammengebunden, sie daran hochgezogen und gefoltert. Zum Glück möchte man sagen, denn zeitgleich wurden viele andere einfach geköpft, ohne dass man ihnen zuvor den Prozess gemacht hätte – ein Schicksal, dem Riemenschneider und seine Mitgefangenen tagtäglich ins Auge sehen mussten. Man kann sich lebhaft vorstellen, wie diese traumatischen Wochen im Festungskerker ihre Spuren im Leben des Meisters hinterlassen haben.
Das ungerechte Leiden findet im überdimensionalen Leichnam Christi seinen beredten Ausdruck im Maidbronner Altar. Die mittelalterliche Bedeutungsgröße unterstreicht den Hauptakteur, Christus selbst. Er, der Gerechte, hat für die Ungerechten gelitten. Durch seine Wunden sind die Wunden der Welt geheilt, wie es so eindrücklich im Ersten Petrusbrief heißt (1Petr 2,24). Hat Tilman Riemenschneider sich an diesem Anblick festhalten können? Konnte er seine Leiden als Mitleiden mit dem Meister und Herrn verstehen? Konnte er mit dem Apostel Paulus im Kolosserbrief gar sagen, er ergänze „in seinen Leiden, was an den Bedrängnissen Christi noch fehlt an seinem Leib, der die Kirche ist“ (Kol 1,24)? Wir wissen es nicht.
Es berührt mich jedenfalls, wenn die Kunsthistoriker sagen, in der Figur des Nikodemus in der Bildmitte direkt unter dem Kreuz des Maidbronner Altares habe sich Tilman Riemenschneider selbst dargestellt. Denn dieser Nikodemus, der in der Tat die Züge Riemenschneiders trägt, hält ein großes Gefäß in den Händen, gefüllt mit kostbarem Öl, um den geschundenen Leib Christi einzubalsamieren. Es ist, als ob der Meister sagen wollte: Seht her, ich selbst will mithelfen, die geschlagenen Wunden zu heilen, ich, der auch ich in das Unglück verwickelt war, das nun über uns alle gekommen ist. Ein tröstlicher Gedanke. Die geschlagenen Wunden zu heilen ist unser aller Auftrag als Kirche. Das Schmerzgedächtnis hält dazu an, die Leidenden nicht aus den Augen zu verlieren, sondern sich ihrer anzunehmen und ihre Schmerzen zu lindern, soweit wir es vermögen.
Die Bitterkeit über die ungerechte Wiederherstellung der ohnehin ungerechten Verhältnisse
Eine dritte schmerzliche Erinnerung bezieht sich auf die sogenannte „Brandschatzung“ des Fürstbischofs nach dem Bauernaufstand. Der Fürstbischof bereiste das Hochstift mit einer Kommission, die die Schäden durch Brände und Plünderungen aufnahm und zugleich die Kosten zur Wiedergutmachung festsetzte. Dabei ging es jedoch nicht um Ausgleich und Wiederherstellung, wie man zunächst gehofft hatte. Im Gegenteil. Die Brandschatzung führte dazu, dass oftmals weitaus höhere Kosten in Rechnung gestellt wurden als zur Behebung der tatsächlichen Schäden vonnöten gewesen wären.
Bitter vermerkt Cronthal in seiner Chronik: „und so wurd jedoch manchs haus, schloss und entwende fahrnus weit, weit höher angeschlagen, dann sie in grund und boden werth gewesen, und in summa manchem sein alte, zerissene rattennester dermassen geschetzt, (…) dass er und etliche seiner vorfahren nie so viel gehabt (…).“ (Cronthal S. 111-112)
Gerechtigkeit sieht anders aus. Anstatt die früheren Verhältnisse, die ohnehin bedrückend waren, wiederherzustellen, wurden sie noch weiter verschlimmert. Am Ende bot sich ein niederschmetterndes Bild der Lebenssituation der Menschen. Auf einen neuen Aufbruch hatten sie gehofft. Nun sahen sie sich um ihre Hoffnungen vollends betrogen.
Die gefühlte Trostlosigkeit wird in der Figur Mariens anrührend in Szene gesetzt. Die Gottesmutter hält zaghaft und zugleich hilflos den leblosen Arm ihres Sohnes, der sich noch im Tod von ihr abwendet. Die verstörten Blicke der anderen Personen sprechen Bände. In der Tat, jeder der schon einmal prozessiert hat, weiß, dass es auf Erden keine vollkommene Gerechtigkeit gibt. Dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Recht haben und Recht bekommen. Auch das gehört zu den schmerzlichen Erfahrungen der Kirche und in der Kirche.
Dennoch warnt der Apostel Paulus vor der Neigung, sich mit Gewalt Recht zu verschaffen, wenn er im Römerbrief schreibt: „Übt nicht selbst Vergeltung, Geliebte, sondern lasst Raum für das Zorngericht Gottes; denn es steht geschrieben: Mein ist die Vergeltung, ich werde vergelten, spricht der Herr. Vielmehr: Wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken; tust du das, dann sammelst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute!“ (Röm 12, 19-21). Besiege das Böse durch das Gute, weil auch Christus das Böse durch seine Güte und Barmherzigkeit besiegt hat. Auch daran mahnt uns das Schmerzgedächtnis der Kirche.
Der Altar als Appell zu weltweiter Solidarität mit den Leidenden
Ich habe versucht, den Maidbronner Altar als Ausdruck der schmerzlichen Erinnerungen zu deuten, die Tilman Riemenschneider prägten im Blick auf die Ereignisse des Bauernkriegs. Ohnmacht, Folter und Ungerechtigkeit – das waren nicht nur seine Erfahrungen. Was er erlebte, durchleben momentan ungezählte Menschen weltweit in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde. Sein Altar wird zur Mahnung, diese Menschen nicht zu vergessen. Ihnen Solidarität zu bezeugen in ihrem Schmerz, ist der Appell, der von Riemenschneiders letzten Steinbildwerk ausgeht und der uns heute noch unmittelbar erreicht – heute an dem Tag, an dem wir der Schmerzen Mariens und der ganzen Kirche gedenken. Amen.